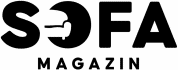Beim Start in das Studentenleben gibt es Erwartungen. Doch ob diese auch nach mehreren Semestern noch konform mit der Realität sind, steht auf einem anderen Blatt.
Vor rund zwei Jahren entschied sich Verena Limmer für den Lehrerberuf. Nun nähert sie sich diesem Ziel mit ihrem Studium in Regensburg an. „Wie schon meine Mutter“, erzählt die 22-Jährige lächelnd. Ihr Wunsch war es, mit „Menschen zusammenzuarbeiten“. Und aus pädagogischer Sicht etwas zu bewirken. Aus den bisher absolvierten Praktika an verschiedenen Mittelschulen musste sie allerdings feststellen, dass „der Mensch nicht im Vordergrund steht, sondern die Klasse“. „Dabei muss die Leistung der Schüler stimmen. Die Probleme der einzelnen Kinder zu lösen, ist eine zusätzliche Last für die Lehrer“, erläutert die gebürtige Münchnerin. Mit diesem Wunsch wagte sich Limmer in den neuen Lebensabschnitt. Dieser hielt neben den ersten Schritten in die private Selbstständigkeit die ein oder andere kleine Überraschung bereit. Auch die Institution Universität stellt Anforderungen, die sie versuchte zu erfüllen.
Obwohl die meisten Studiengänge in ihrer Bezeichnung das Wort „Wissenschaft“ enthalten ist den wenigstens Studierenden bewusst, dass trockene Vorlesungen und realitätsferne Thematiken Teil des Uni-Alltags sein können. So erging es auch Limmer, die sich ihr Studium „viel praxisnaher und spannender“ vorgestellt habe. Sie findet es „extrem schade, dass das Wissen, das an der Uni gelehrt wird, nicht sofort angewendet werden kann“. Dies eigne man sich erst in der darauffolgenden Referendariatszeit an.
Zwischen Erwartung und Realität
Neben ein paar Wahlfächern und vereinzelten Seminaren fehlt dem Studiengang der Bezug zum Alltag und auch dem späteren Berufsleben“
Mit ähnlichen Erwartungen hat auch Kim Carolin Stange ihr Studium der Kommunikationswissenschaft in Salzburg begonnen. Sie habe sich zwar schon gedacht, dass die wissenschaftliche Komponente gegeben sei, allerdings habe sie trotz allem die „Hoffnung auf viele praxisorientierte Übungen und Seminare rund um Design“ nicht aufgegeben. „Die Überraschung war dann doch sehr groß“, fügt die 20-Jährige hinzu, die sich selbst als „Numerus-Clausus-Flüchtling“ beschreibt. „Neben ein paar Wahlfächern und vereinzelten Seminaren fehlt dem Studiengang der Bezug zum Alltag und auch dem späteren Berufsleben“, erzählt die gebürtige Würzburgerin. Ihr eigentlicher Wunsch war es, einen kreativen Studiengang im gestalterischen Bereich zu absolvieren, doch dafür habe es aus zeittechnischen Gründen nicht gereicht.
Heute wird versucht, die Studenten einzubinden
Dass sich dahinter ein Denkfehler verstecken könnte, bemerkt Andreas Böhm, der als Dozent am Fachbereich Psychologie in Salzburg lehrt. Es müsse zunächst ein „theoretisches Fundament“ gegeben sein, das bei jedem ähnlich auszusehen hat. „Auf diesem kann nun das Haus errichtet werden, das sich nach oben hin individuell formt, je nach Spezialisierungsgebiet“, sagt Böhm. Zu früheren Zeiten sei den Studierenden eine deutliche passivere Rolle zugekommen. „Eine Vorlesung glich dann tatsächlich eher einem monologartigen Frontalvortrag. Heute wird versucht, die Studenten selbst in gewöhnliche Vorlesungen mit einzubinden“, ergänzt der 29-Jährige. Sein Verbesserungsvorschlag: mehr Vorlesungen mit Übung gestalten. „Wenn die dementsprechenden Mittel bereitgestellt werden und dem lehrenden Professor noch drei Doktoranden zur Seite stehen, ist so auch ein praxisnaher Unterricht mit einer größeren Gruppe möglich.“
Freude am Fach steht nicht im Mittelpunkt
Doch nicht bloß die Konzeption der Studienpläne spaltet die Erwartungen der Studierenden und die Wirklichkeit der universitären Lebenswelt. Auch die Leistungsanforderungen, die von den Professoren gestellt werden, und die Motivation der Kommilitonen entsprächen nicht den Vorstellungen, die sie nach dem erfolgreichen Abschluss der Schulzeit hatten. „Der Grund für ein Studium sollte doch die Freude an dem Fach sein und das große Interesse daran“, beschreibt Limmer. Doch die Realität sehe ganz anders aus: „Die Seminare werden nur wegen der Anwesenheitspflicht besucht, die restlichen Vorlesungen meistens geschwänzt“, kritisiert sie.
Kein nachhaltiges Lernen
Auch Moritz Fink, der sich vor zwei Jahren einen Studienplatz am Fachbereich Psychologie in Salzburg sichern konnte, hat sich sein Studium „deutlich schwieriger“ vorgestellt. „Leider genügt schon ein geringer Aufwand, um die Prüfungen zumindest zu bestehen“, sagt der 22-Jährige. Dieses sogenannte Bulimie-Lernen (Lernen einer großen Stoffmenge kurz vor der Klausur, um dieses anschließend schnell wieder zu vergessen) sei für Fink zwar nicht erstrebenswert, aber das Konzept der Modulprüfungen wirke doch sehr einladend. „Was man aus dem Gegebenen macht, ist einem natürlich selbst überlassen“, erzählt der gebürtige Augsburger. Das ehemalige Diplomstudium der Psychologie sei in dieser Hinsicht wertvoller gewesen. „Wenn du das Wissen aus mehreren Semestern in einer Prüfung anwenden musst, lernst du natürlich auch nachhaltiger“, fügt Fink hinzu.
„Mit so viel Statistik habe ich nicht gerechnet“
Multiple-Choice-Prüfungen seien erforderlich, um das Wissen einer großen Menge an Studierenden zu prüfen. „Der Aufwand bei anderen Prüfungsarten wäre schlicht und einfach zu groß“, sagt Böhm. Um diese „krankhafte“ Art des Lernens zu umgehen, fordert er mehr Transferfragen und die Neugestaltung von bestehenden Klausuren.
Nach dem Abschluss ihrer „mathematischen Laufbahn, die nicht gerade vorzeigewürdig ist“, glaubte Stange, sich nie wieder mit diesem Fach auseinandersetzen zu müssen. „Mit so viel Methodenlehre und Statistik habe ich überhaupt nicht gerechnet“, erzählt die KoWi-Studentin. Auch am Fachbereich Psychologie werden Kenntnisse der quantitativen und qualitativen Forschung gelehrt. Für Fink sei die Vermittlung von dem statistischen Wissen zwar auch überraschend gewesen. Allerdings findet er es „nicht schlimm, eher sinnvoll“. „Egal ob man später in der Forschung oder dem Therapiebereich arbeiten möchte: Eine Studie kritisch hinterfragen zu können, ist immer nützlich“, fügt Fink hinzu. Die Skepsis, die einige gegenüber der Methodenlehre haben, sei dem Sozialpsychologen Böhm auch schon aufgefallen. „Da man den praktischen Nutzen nicht sofort erkennt, ist den wenigstens Studierenden bewusst, wie wichtig Statistik tatsächlich ist“, erzählt Böhm. Besonders in der Psychologie sei es notwendig, dieses „Handwerkszeug“ zu verstehen.
„Früher war alles besser“
Gegen die nostalgische Weisheit „Früher war alles besser“ wehrt sich der Lehrbeauftragte. „Wir tendieren allgemein dazu, das Negative aus der Vergangenheit auszublenden. Und das Positive gleichzeitig überzubewerten“, sagt Böhm. Ein Studium habe einen wissenschaftlichen Anspruch, den es zu erfüllen gelte. Um allerdings die Qualität des Lehrens zu erhöhen, müsse der Druck auf wissenschaftliche Erfolge genommen werden. Die Lehre darf nicht als „notwendiges Übel mit geringer Entlohnung“ angesehen werden. Sondern mit eigens dafür eingerichteten Stellen gefördert werden. „Solche Senior-Lecturer-Stellen, die es schon im englischsprachigen Raum gibt, sind auch in Salzburg stark im Kommen. Das ist es, was die Universität braucht“, fordert Böhm.